Pirmasens „Zum Glück hatten wir Montreux“
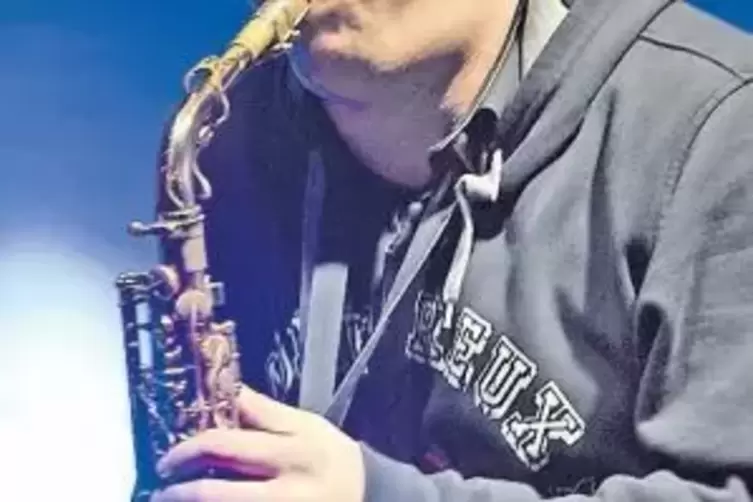
Die „Brass Machine“ um den Pirmasenser Saxofonisten und Bandleader Jens Vollmer ist ein Show-Ensemble mit beträchtlicher Publikums-Attraktivität. In diesem Jahr wurde die Band, die in der Stammbesetzung mit nicht weniger als elf Musikern, darunter als Markenzeichen ein kompletter dreiköpfiger Bläsersatz, antritt, 15 Jahre alt. Fred G. Schütz unterhielt sich mit Jens Vollmer über die Auftritte von „Brass Machine“ beim Montreux Jazz-Festival, professionelles Band-Marketing und darüber, was es mit dem Band-Slogan „Say no to sampled horns“ auf sich hat.
Ja. „Brass Machine“ wurde vor 15 Jahren gegründet. Es gab vorher eine Sessionband in der Kammgarn – die wollten wir weiterführen. Dann haben wir einen Namen gesucht und spielten als „Brass Machine“ erstmals im August 2001 beim Trifels-Open-Air. Dann folgten weitere Sessions, zum Beispiel in der Südpfalz mit Sascha Kleinophorst, Markus Eisel und Maika Kiefer, „Nachtcafé“ hießen die, glaube ich. Und da entschieden wir, weiterzumachen. Die Sängerinnen und Sänger haben allerdings recht häufig gewechselt. „Brass Machine“ versteht sich aber nicht als Begleitband für Gesangssolisten? Nein, das war nicht das, was wir wollten. Wir wollten schon, dass die Bläser im Mittelpunkt stehen. Ist das noch ein Alleinstellungsmerkmal? Na gut, einige haben das nachgemacht. Aber dadurch, dass die Situation für alle Bands schwieriger geworden ist, sagen viele, wir kommen nur als drei-, vier-, fünf-Mann-Band, und spätestens dann ist es vorbei, weil die dann in der großen Besetzung nicht mehr auf ihre Gage kommen. Wenn man dann aber auch im größeren Umkreis spielt, wird man als größere Band auch schon mal für die größeren Bühnen angefragt. „Brass Machine“ hat elf Mitglieder. Der wichtige Punkt ist aber – das habe ich auch bei meiner Vorgängerband „Peppermint Patty“ gesehen –, dass sich manche Bands in einer Gegend totspielen; man ist angesagt und spielt jedes Wochenende. Das wollte ich mit „Brass Machine“ von Anfang an anders machen. Ich hatte ja die Kontakte durch mein Musikmagazin „Feedback“, so dass ich auch Veranstalter aus ganz anderen Regionen ansprechen konnte – aus ganz Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und Hessen. Das war schon eine andere Basis. Aber trotzdem ist es schwierig, mit einem neuen, noch unbekannten Namen, etwas auf die Beine zu stellen. 2002 haben wir wirklich viel gespielt, 80 Auftritte – mit Promotion-Auftritten im Radio, mal mit der „Kelly Family“, einfach Sachen, die wichtig waren, um uns bekannt zu machen. Glücklicherweise hatten wir auch gleich das Montreux Jazz-Festival. Wie sind Sie da dran gekommen? Über meine Kontakte. In Montreux gibt es ja nur eine Open-Air-Bühne. Die Bühnen in den Sälen sind für die Top-Acts reserviert. Die Bühne draußen ist vergleichbar mit einer Stadtfestbühne, nur, dass die Bands aus der ganzen Welt kommen. Allerdings nehmen sie deutsche Bands nicht gerne. Ich beobachte das seit Jahren: Von über 200 Bands ist maximal eine aus Deutschland. Wir haben jetzt zweimal dort gespielt, 2002 und 2007. Das war sicher hilfreich für die Band? Genau. Wir hatten das erste Konzert auch gleich aufgezeichnet, womit wir sofort eine ganz andere Referenz hatten. Damit konnten wir 2003 bei Stadtfesten schon mal punkten, wo sich oft 200, 300 Bands bewerben. Die meisten Bands hatten da noch Tapes verschickt, ganz wenige Studio-CDs. Dann kamen wir und verschickten eine CD „Live in Montreux“ – das ist schon eine andere Nummer. Bei der Personalstärke ist „Brass Machine“ aber auch auf entsprechend große Auftrittsmöglichkeiten angewiesen, der kleine Club-Auftritt würde da nicht ganz passen…? Das haben wir anfangs gemacht – da war ja in den Clubs auch noch was los, zum Beispiel im Quasimodo. Das war damals gerade insolvent und wir hatten den Insolvenzverwalter angerufen, Heizöl bestellt und ein Konzert veranstaltet. Da kamen 800 Leute. Clubs waren auch immer gut, um neues Material auszuprobieren oder potenzielle Veranstalter einzuladen. Und man hat natürlich auch Kritiken bekommen. Auf einem Stadtfest schreibt niemand eine Kritik, im Club schon. Das war für die Mappe schon wichtig, nicht nur das Geld. Wie wird neues Material ausgewählt und einstudiert? Haben wir ein neues Lied, wird das herumgeschickt. Man muss halt, das ist wichtig, professionell vorgehen. Erstmal muss die Version klar sein. Unser Keyboarder schreibt dann ein Sheet und die Bläsernoten. Dann sehen wir, dass wir bei einem Soundcheck etwas mehr Zeit haben und spielen das neue Lied ein- oder zweimal durch – dann muss es passen. Unseren eigenen Stempel drücken wir dadurch drauf, dass wir mal eine Synthie-Linie durch die Bläser ersetzen oder auch eine Gitarrenlinie mit dem Blech verstärken. Ein Beispiel ist das Lied „Take On Me“ von „A-ha“, das wir statt mit Synthies mit Bläsern spielen – so wirkt es gleich ganz anders. Ihr Slogan heißt „Say no to sampled horns“. Ist das auch ein Verweis auf die Qualitäten der Band? Ganz klar. Wir spielen handgemachte Musik und die richtig. Es gibt Bands, die spielen „Blues Brothers“ ohne Bläser – das tut mir in der Seele und in den Ohren weh. Mancher Keyboarder kann sich schon gar nicht mehr vorstellen, wie so ein echter Bläsersatz klingt. Da wir häufig mit Gästen auftreten, kriegen wir auch von denen die Rückmeldung, wie viel besser das mit richtigen Bläsern klingt. Es stehen ja nicht alle Bandmitglieder für jedes Konzert zur Verfügung, da viele auch in anderen Bands spielen. Wie organisieren Sie das? Wir haben pro Instrument etwa fünf Musiker, die mit dem Repertoire vertraut sind. Das gibt schon Sicherheit. Sollte es mal gar nicht klappen, habe ich genügend Kontakte zu wirklich guten Musikern. Allerdings sind bei uns auch die Arrangements und Abläufe ganz klar festgelegt. Das ist wichtig. Ich habe manche Session-Band aus dem Mannheimer Raum gehört, wo es heißt, „ja, den Song hab ich schon mal gespielt“. Das klingt dann aber auch so. Da fallen alle Feinheiten, alle Besonderheiten weg. Das geht dann nach dem Motto, Hauptsache, es fangen alle gemeinsam an und hören gemeinsam auf – manchmal sogar im selben Lied. Wo kommen Sie musikalisch her? Ich habe ganz klassisch in der Blaskapelle Schopp in der Jugendkapelle begonnen. Dann kam ein Kumpel von mir, der erzählte, „ich geh jetzt nach Lautern in die Musikschule, da macht jetzt gerade eine Big Band auf“. Ein paar Monate später bin ich hinterher. Das war der entscheidende Schritt zu einer anderen Musik, mit Improvisation konfrontiert zu werden. Parallel dazu wollte ich in die Tontechnik gehen, hatte aber auch noch das Musikmagazin „Feedback“ gegründet. Das wurde dann immer mehr, so dass ich das Studium aufgab. Infos www.brassmachine.de. |tz
