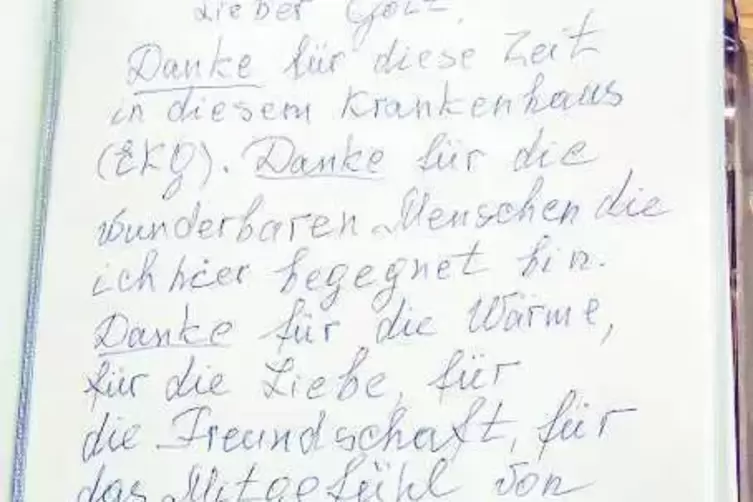Zweibrücken Der letzte Tag im Evangelischen Krankenhaus

Reportage: Eine offizielle Abschiedsfeier gibt es nicht. „Wir werden ganz normal arbeiten“, hat Mitarbeitervertreter Thomas Stauder angekündigt. Geht das überhaupt, wenn gut 400 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren? Ein Rundgang.
Klein und unscheinbar ist er. Der Zettel. Er klebt von innen an der Tür. „Wir schließen“ steht darauf. Und weiter: „Zur stationären medizinischen Versorgung steht Ihnen künftig das Nardini-Klinikum zur Verfügung.“ Immerhin. Bis vor kurzem suchten Besucher hier noch vergeblich nach Hinweisen zur Schließung des Krankenhauses. Es ist der letzte Tag im Evangelischen. Wie ist es da? Geschäftig und überraschend laut – zumindest in der Eingangshalle. Wie in einem Bienenstock eilen Mitarbeiter durch die Flure, mit Zetteln, Kisten oder Bilderrahmen in den Händen. „Das muss jetzt alles weg“, hört man eine Frau sagen. „Ich versteh’s nicht“, sagt eine andere sichtlich betroffen. Manche haben auch kleine Blumensträuße in den Händen. Immerhin eine kleine Aufmerksamkeit zum Abschied. In den Ecken stehen leere Getränkekisten, Rollstühle. Eine Frau schlägt die Hände vors Gesicht, unterdrückt ein Schluchzen. Eine Gruppe von jungen Ärzten in weißen Kitteln läuft zum Aufzug. Für sie wird das Gebäude in der Oberen Himmelbergstraße ihr Arbeitsplatz bleiben. Denn die Innere Abteilung wird vom Nardini weitergeführt. Über dem Haupteingang macht sich eine Gruppe von Männern gerade an der großen lilafarbenen Plane zu schaffen. „Evangelisches Krankenhaus Zweibrücken“ steht in großen, weißen Lettern darauf. Nun wird sie abgemacht. Ein sichtbares Zeichen, dass es zu Ende geht. Für die zierliche Frau mit den kurzen braunen Haaren, die eben noch im Kiosk nebenan gearbeitet hat, ist dieser Morgen zu viel. Nachdem sie die Kiosktür für immer abgeschlossen hat, bricht sie in Tränen aus, schluchzt laut, wo andere nur still ins sich hineinschniefen. Drei Kolleginnen versuchen sie zu trösten. Dann machen sie sich gemeinsam auf zur Cafeteria. Auch dort gibt es nichts mehr zu essen. Hier sitzen jetzt Mitarbeiter beisammen, geben sich gegenseitig Trost. Auf die Sitzgruppe vor der Cafeteria hat sich ein älterer Herr gesetzt und isst Schokolade. Alle grüßen ihn oder nicken ihm beim Vorbeigehen zu. Ein Patient? „Ich habe hier neun Jahre zu Mittag gegessen“, erzählt er stattdessen. Um 10 Uhr habe die Cafeteria für immer zugemacht. „Hat sich nicht mehr rentiert.“ Jetzt gehe er eben ins Awo-Seniorenhaus essen. „Die kochen dreimal am Tag frisch, hier war’s ja nur aufgetaut.“ Nüchtern sagt er das. Fügt dann aber hinzu: „War ein gutes Krankenhaus, freundliche Leute.“ Im Treppenhaus ist Thomas Frank, der Pflegedirektor des katholischen Krankenhauses, auf dem Weg nach unten. Lächelnd läuft er in Anzug und Krawatte durch das Haus. Auch viele Mitarbeiter, ob Ärzte und Schwestern, grüßen freundlich. Lächeln tapfer und lassen sich den Verlust nicht anmerken. Andere stehen auf den Stationen in Grüppchen zusammen und unterhalten sich leise. „Ich fühle mich nutzlos“, flüstert eine Schwester niedergeschlagen. Beim Vorbeilaufen verstummen die Gespräche. Im dritten Stock lebt das Krankenhaus weiter. Hier ist die Innere Abteilung, hier sollen Menschen mit Bauchkrankheiten weiter behandelt werden. Nur: Nach Krankenhausalltag sieht auch hier wenig aus. „Nein, momentan keine Patienten“, sagt eine junge Ärztin kurz angebunden. Man sitzt zusammen im Ärztezimmer. Die gleiche junge Schar in Weiß, die eben noch im Erdgeschoss zusammenstand. Für kurze Zeit arbeitslos, aber nicht für lange. Alle Türen rechts und links des Ganges stehen weit auf, genau wie die Fenster. Ein kühler Wind weht durch den Bau. Durchzug. Weg mit der muffigen Krankenhausluft. In den Zimmern stehen leere Krankenhausbetten, die Laken abgezogen, aber ohne Plastikplanen wie auf den anderen Stationen. Sie werden schließlich noch gebraucht. Je weiter es nach oben geht, desto ruhiger wird es. Bald hallen nur noch die eigenen Tritte über den beige-grauen Plastikboden. Gespenstisch leer ist es im sechsten Stock. Kein Mensch ist hier mehr anzutreffen. Die Lichter sind gedimmt, in manchen Gängen auch schon ausgeschaltet. In den Zimmern sind die Betten bereits weggerollt, nur Tische, Stühle und die Nachttischchen mit den Rollen stehen noch herum. In anderen Räumen stapeln sich Aktenordner, Umzugskisten – mit der Aufschrift „Kittel steril“ – und haufenweise blaue, schmale Bücher. „Neues Testament“ ist darauf in goldenen Buchstaben zu lesen. An der Wand lehnen abgehängte Bilder, klassisch oder abstrakt, Blumen- und Landschaftsmotive. Nach unten hin wird es wieder lauter. Gesprächsfetzen dringen nach oben. Im zweiten Stock steht die Frau aus dem Kiosk, umringt von ihren Freundinnen. Der größte Schmerz von eben scheint verflogen, sie lächelt wieder und erzählt über ihre Pläne für den Abend. „Ich mag nicht Tschüss sagen“, sagt sie. Eine Kollegin drückt ihr beide Arme. „Alles Gute“, klingt es durch das Treppenhaus. Vor der Cafeteria sitzt immer noch der ältere Herr, der jetzt zur Awo essen gehen muss. Er schmunzelt. An den geschäftigen Empfangsdamen vorbei – sie machen sich gerade an einem Haufen Schlüssel zu schaffen – geht es durch den Eingang nach draußen. Der Blick wandert nach oben: Die lila Plane ist weg. Eine Lücke bleibt.